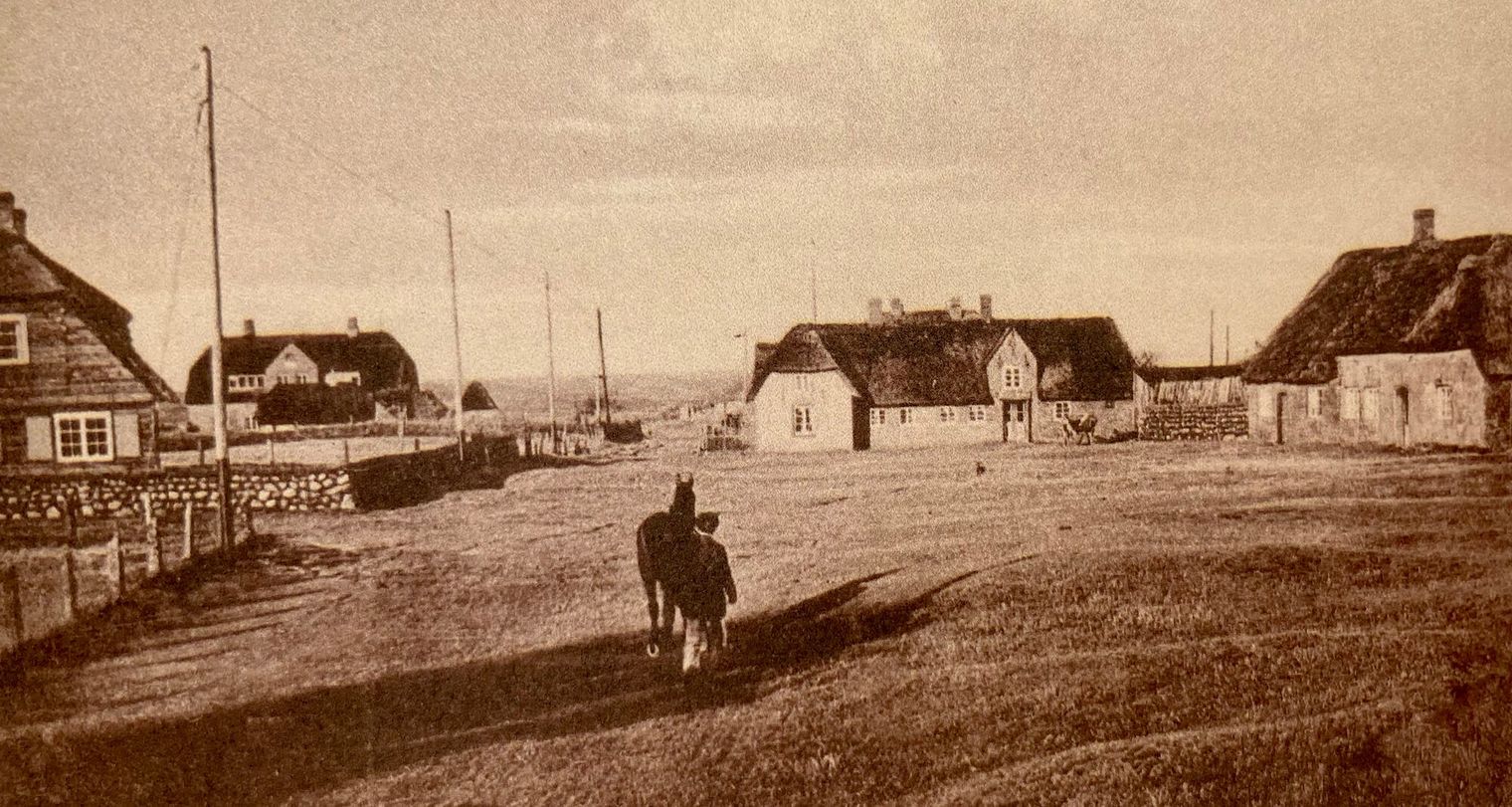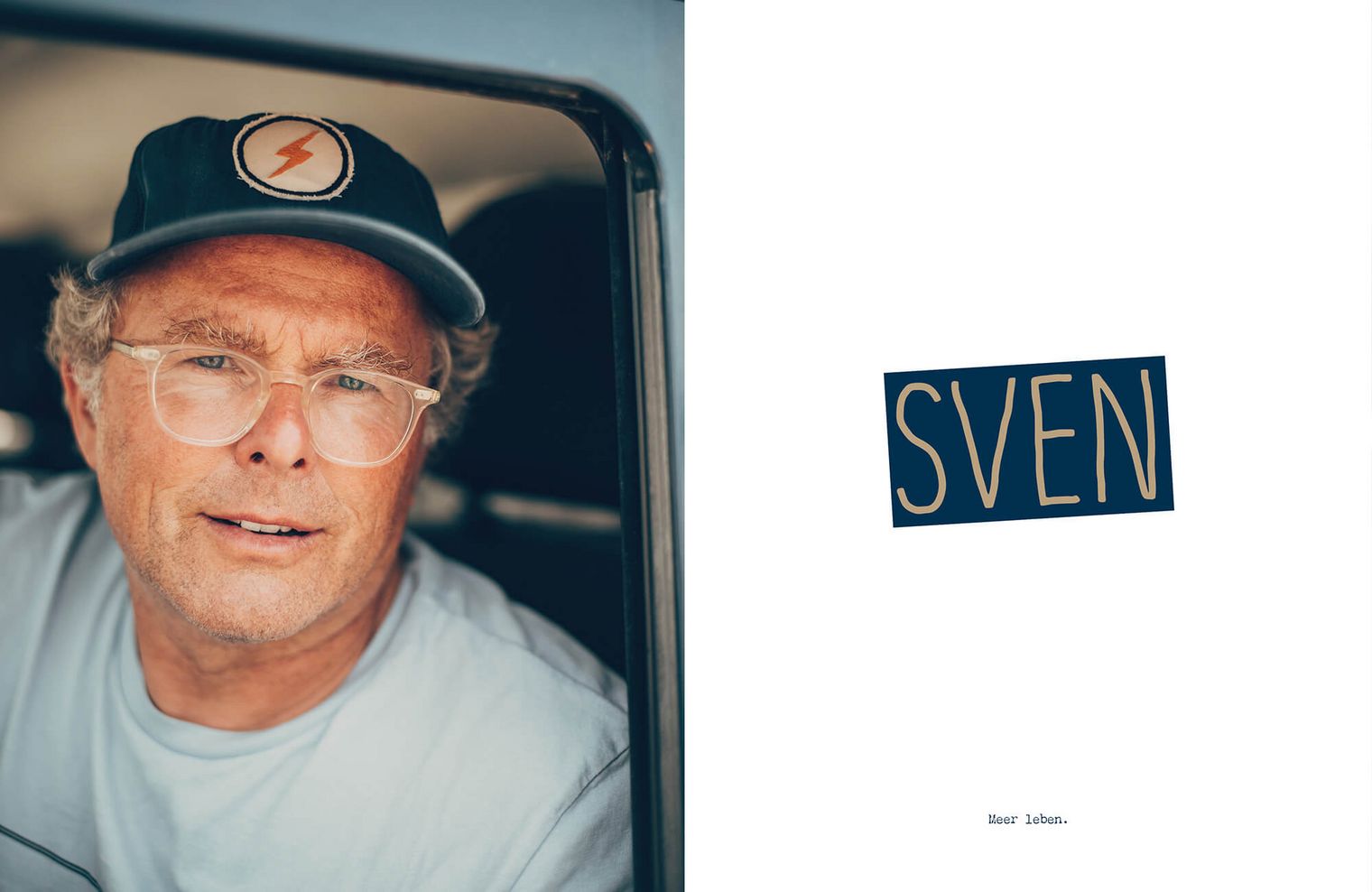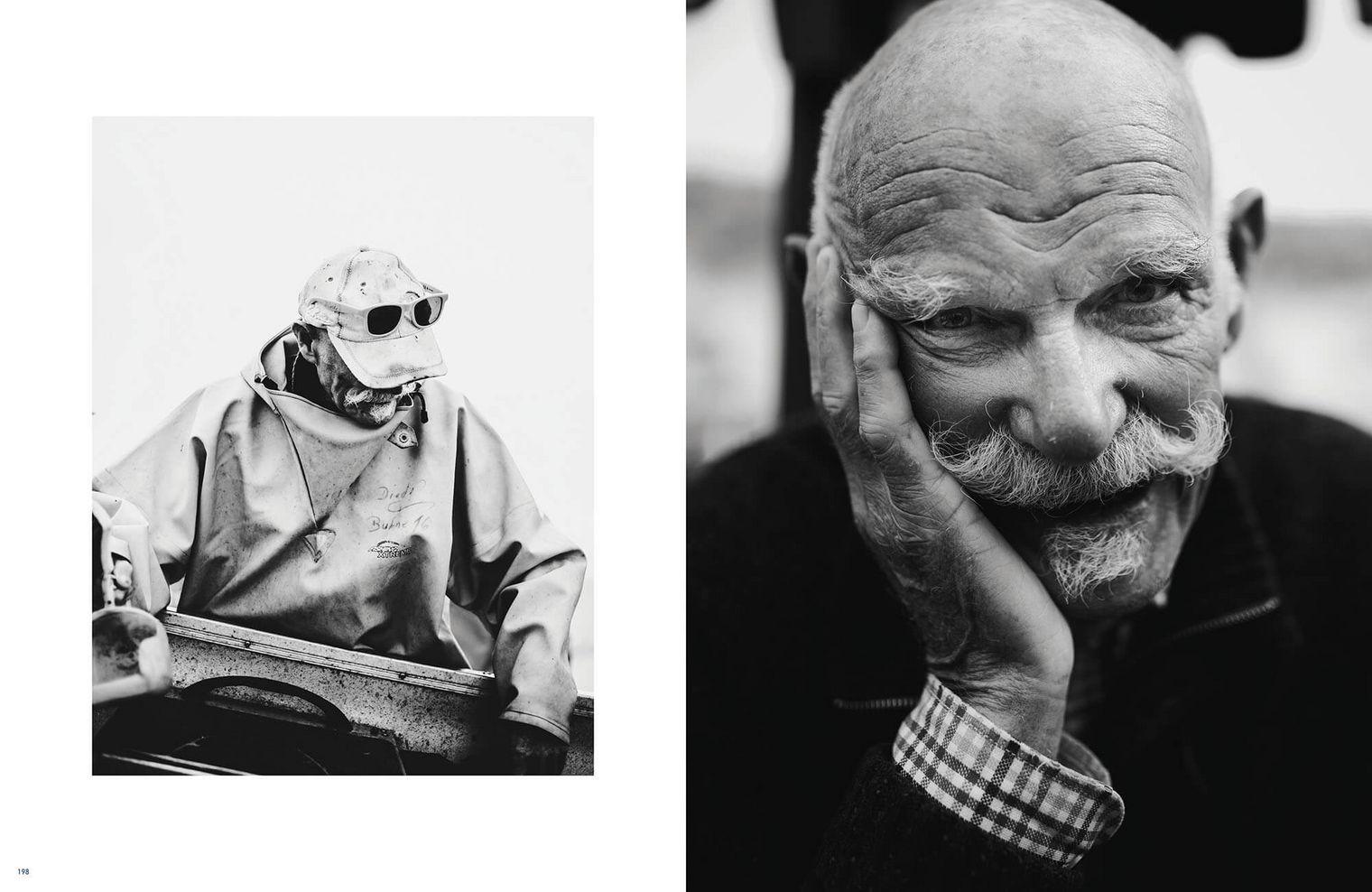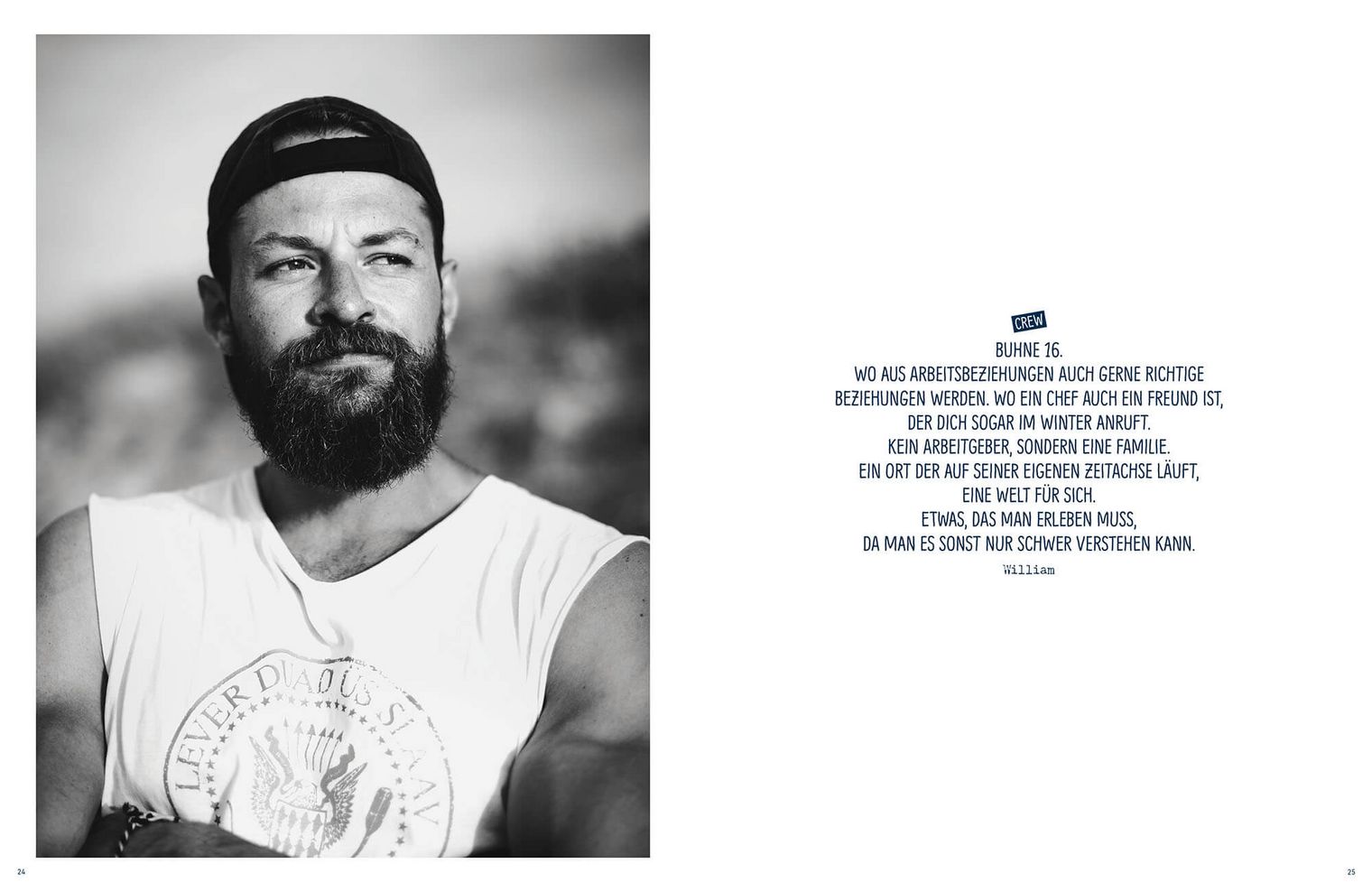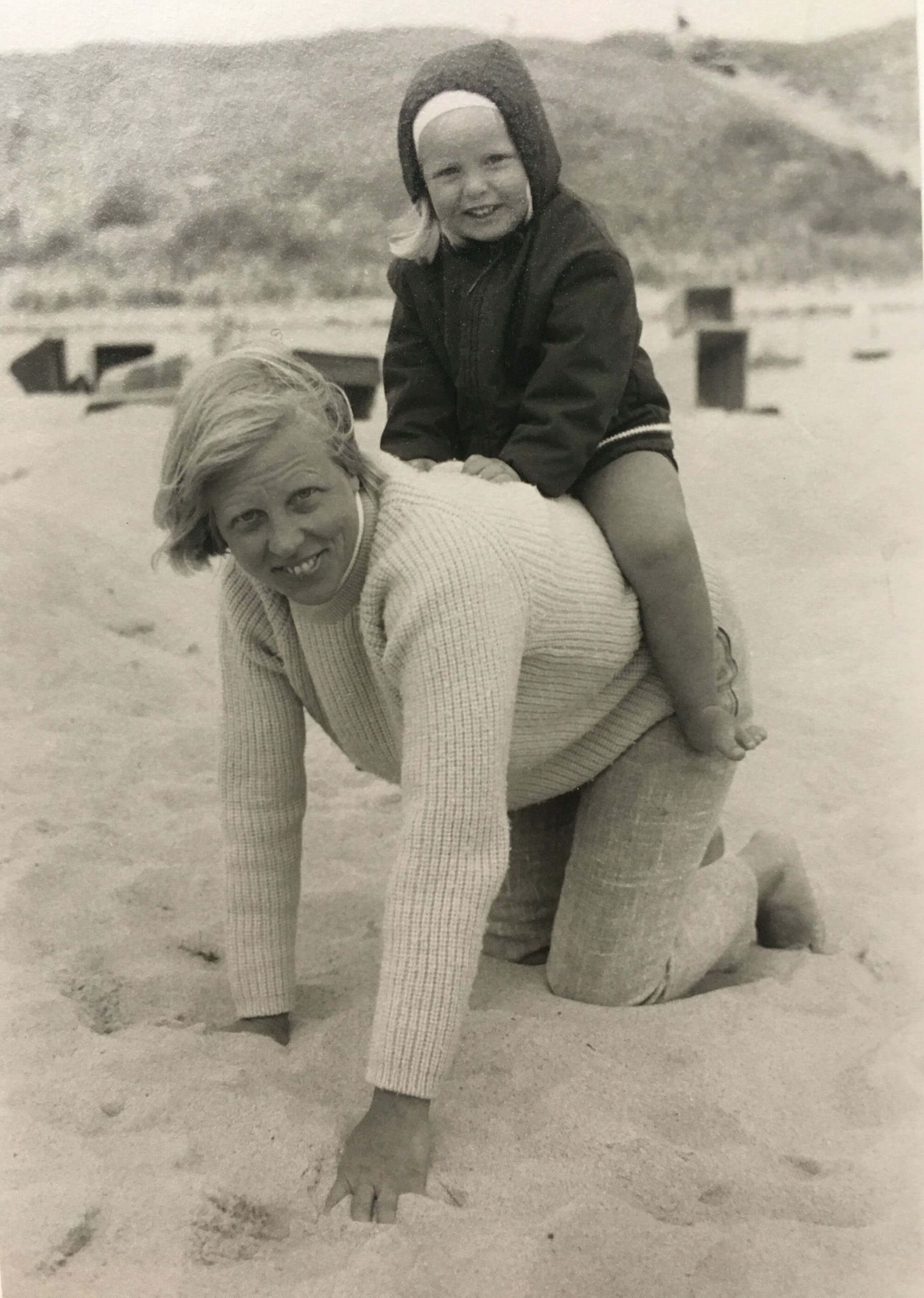Die Zeit, als Sylt den idealen Nähboden für Freigeister bot, siedeln Inselkenner wohl eher im letzten Jahrhundert an - Schwerpunkt 50er bis 90er Jahre. Gret Palucca, Valeska Gert, Maler Sprotte oder Wirte wie Klaus Bambus… Das Image der Insel speiste sich zu Teilen aus seinen „bunten Vögeln“. Heute ist die Zahl der Locals mit exzentrischen Lebensentwürfen eher klein. Bohème und Avantgarde sind dem Mainstream gewichen. Eine Handvoll Künstler und Kreative, kantige Gastgeber und Freigeister, denen das Leben am Meer, im freilassenden Insel-Mikrokosmos den Nährboden bietet, findet man aber glücklicherweise immer noch. Halima Elkasmi ist ein Paradebeispiel.
Gerade kommt sie aus dem Meer. Kein spektakuläres Wintergeplansche vor Publikum wie beim Weihnachtsbaden. Es handelt sich vielmehr um Halimas stillen Akt, das Leben zu feiern. Ein Ritual. Ein Anker. Der Moment, um sich mit sich selbst zu verbinden. „Reconnecting" ist das Schlagwort. „Ich setz mich einfach eine Weile ins eiskalte Wasser, atme und schaue, was mein Körper mir so erzählt. Herrlich ist das - man kommt bei sich selbst an“, versichert die Trainerin, Therapeutin und Lebenskünstlerin.
Das Werkzeug, um in Verbindung mit sich zu treten, ist für Halima der Schlüssel zu einem glücklichen Lebensentwurf. Und diese Methoden gibt sie in Workshops, Trainings, Vorträgen und Retreats weiter. Wenn sie nicht gerade in der Welt arbeitet, lernt oder reist, ist sie seit Jahren am liebsten Sylterin. Die Insel bietet ihr Verwurzelung, Überschaubarkeit, Zuhause, dörfliche Nähe, vor allem aber die Freiheit und Toleranz, die sie braucht, um zu blühen.
Aufgewachsen ist sie mit neun Geschwistern und einer glücklichen Kindheit dort, wo noch vor kurzem Kohle abgebaut wurde. Das war nämlich der Job ihres geliebten Papas. Die bestmögliche Version ihrer selbst zu werden und sich dafür von allen Schablonen zu befreien, das Fundament dafür hat sie von ihrer Familie bekommen. „Ich konnte als Kind nie still sitzen. Statt mir Medikamente zu geben, haben meine Eltern mich mit Sport gefordert. Ich trainierte Taekwondo und brachte es bis zur Jugendweltmeisterschaft“, berichtet das Temperamentsbündel.
Früh musste sie mit Schmerzen und Verletzungen umgehen. Beim Spiel mit Pfeil und Bogen verlor sie ein Auge. Im Sprunggelenk musste ihr Knorpel transplantiert werden. Sie merkte, dass sie ihre Haltung ändern, ganzheitlicher leben musste, um schmerzfrei und gesund zu sein. Sie wurde in Indien Yogalehrerin und erwarb viele weitere Qualifikationen, Anatomie und Neurologie begeisterten sie insbesondere.
Das moderne Bewegungstraining à la Halima hat nur am Rande mit vertrauten Konzepten zu tun. Mit ihr klingt es, den eigenen Körper auf allen Ebenen neu zu entdecken, vergessene Bewegungen zurückzuerobern. Die schöne Frau mit den marokkanischen Wurzeln hilft auch Sportler*innen mit Verletzung, wieder voll in die Kraft zu kommen. „Einfach mal machen. Wenn meine Klienten bereit sind zu üben, kommen wir zum gewünschten Ziel“, weiß sie. „Practice what you preach“, ist noch so ein Grundsatz, der Halima überzeugend macht.
Mit ihrer umtriebigen Veranlagung braucht sie die unterschiedlichsten Aktivitäten, um ausgelastet zu sein. Natur und Strand sind ideal zum Auspowern und um wieder in die Mitte zu finden. Dass Hyperaktivität eine Qualität und kein Makel ist, wenn man sie in die richtigen Bahnen lenkt, beweist sie täglich. „Nicht gegenan arbeiten, sondern damit umgehen“, ist ihr Credo. Daher überrascht es auch kein Stück, dass sie als Puzzleteil ihres bunten Portfolios manchmal - wie schon vor 15 Jahren - als Servicekraft im „Samoa-Seepferdchen“ aushilft. „Ich liebe den Job. Er fordert mich und hat mir damals meine vielen Ausbildungen und Reisen finanziert. Jeder Abend hat eine eigene Dramaturgie. Es ist wie auf einer Bühne. Wenn Du voll fokussiert bist, wird die Vorstellung gut.“