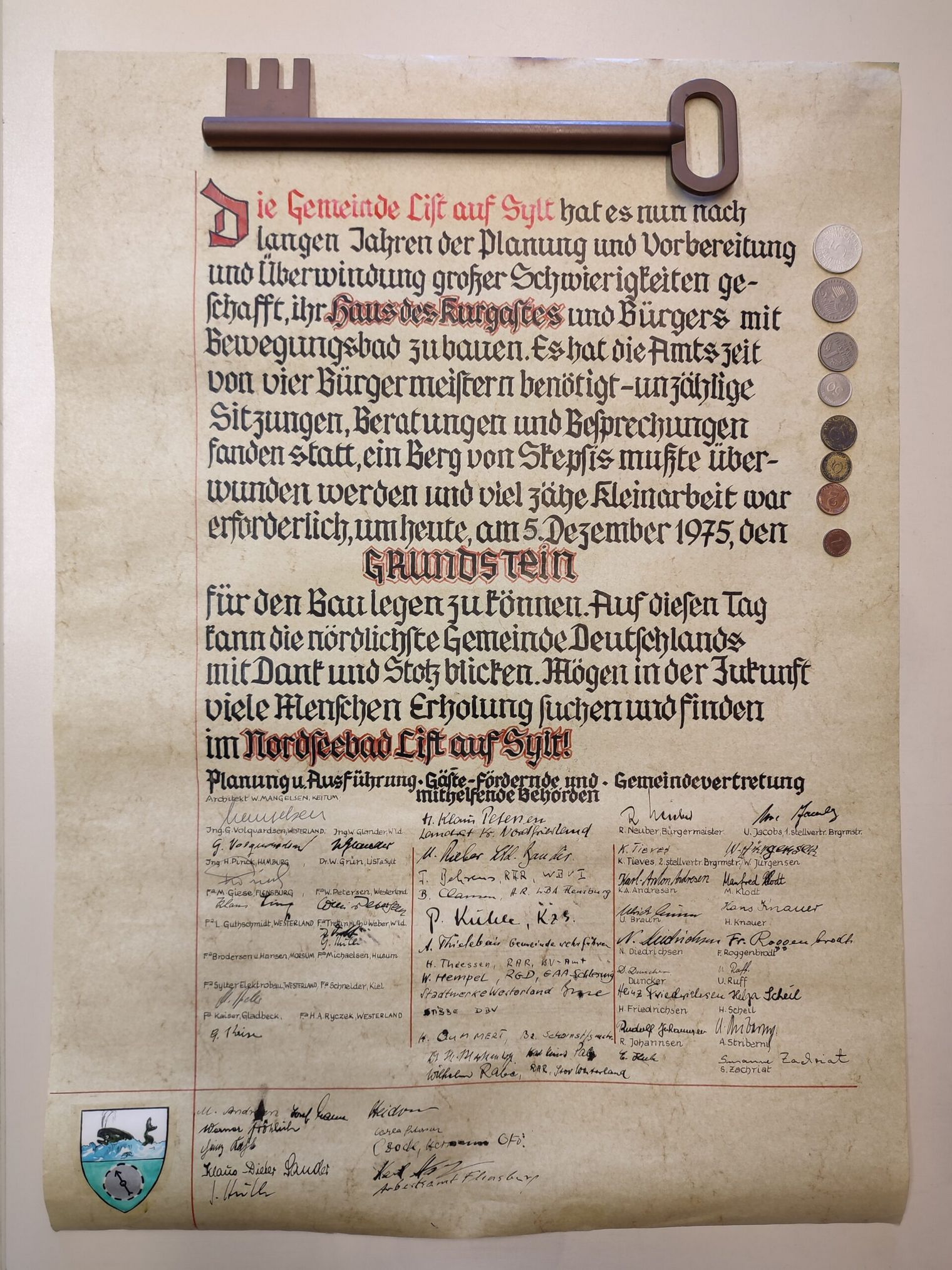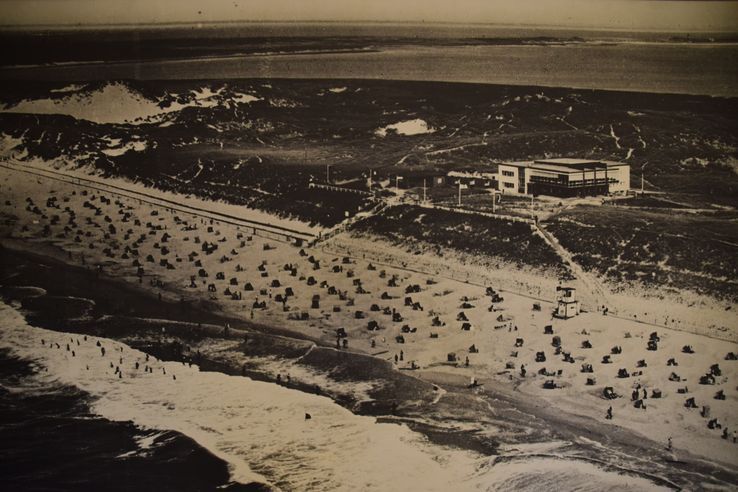Der Lister Zollstein
Vor 337 Jahren ließ der Dänische König Christian V. in List auf Sylt einen Zoll für den Schiffshandel einrichten. List war, anders als das übrige Sylt, Dänemark zugehörig. Das Gewässer um den Hafenort List bot dem Handelsverkehr auf dem Wasserwege besonders gute Voraussetzungen, so dass der Schiffsverkehr stetig zunahm. Die Handelspartner aus den umliegenden Ländern segelten die Westküste entlang und tauschten ihre Fracht in den Hafenorten. Da die umliegenden Gewässer des Lister Tiefs zum Herzogtum Schleswig bzw. Königreich Dänemark gehörten, galten automatisch unterschiedliche Gesetze, die automatisch zu diversen Warenströmen führten.
Dieser Handel war nicht Gesetzeskonform und ließ somit den Schmuggel aufblühen. Dies alles geschah im Lister Tief bis 1680 zollfrei – dann schob König Christian V. dem Treiben im Lister Hafen einen Riegel vor und allen Schiffen, die über List auf Sylt zum Festland oder entlang der Westküste segelten, wurde dadurch Einhalt geboten.
Um die neue Zollverordnung zu koordinieren sorgte der König für den Bau einer Zollstätte. Die Zollkammer wurde errichtet und im Ostgiebel über der Eingangstüre mit einem Zollstein versehen. Dieser Zollstein ist im Sylter Heimatmuseum ausgestellt. Als Material wurde Sandstein genutzt und das Monogramm des Königs Christian V. sowie dessen Wahlspruch „Pietate et Justitia“ (Frömmigkeit und Gerechtigkeit) eingearbeitet. Außerdem lässt sich die Jahreszahl 1682 vorfinden und im unteren Feld ist auf Dänisch vermerkt: „ListerDybsToldCammer“ (Lister Tief Zollkammer).
Die Freude bei den Händlern über diese zusätzliche finanzielle Belastung hielt sich in Grenzen. Sie versuchten den Zoll zu umgehen und umschifften List auf Sylt. Dies führte dazu, dass der König erneut, unter Androhung von drastischen Strafzöllen, auf die Abgabe verwies. Fortan mussten alle Schiffe, die Sylt passierten, mindestens in List anlegen und ihre Gebühr entrichten. Wer dies nicht leisten konnte, sollte seinen Zoll bei den umliegenden Zollstationen wie bspw. Amrum entrichten.
1694 wurde die Lister Zollstation nach Hoyer verlegt. Über die Zollabgaben wurde weiterhin debattiert. Sylt erhielt erst 1816 wieder eine Zollstelle. Diese dann in Keitum, da der Lister Hafen versandete. Später wechselte das Amt nach Westerland über.
Was passierte mit dem Lister Zollhaus? Die Lister erhielten die Möglichkeit, gegen ein geringes Entgelt dort zu wohnen. So zog 1829 Hans Nielsen in dieses Haus, 1830 wurde dann die Witwe von Niels Möller Besitzerin der ehemaligen Zollstation.
Letztlich wurde das Haus 1935 abgerissen. Der Stein blieb als Erinnerung und Zeugnis dieser spannenden Sylter Geschichte.